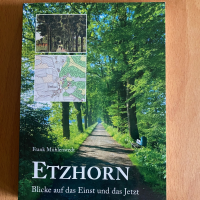Christian Brandt ist seit dem 1. Oktober 2021 der neue Kontaktbereichsbeamte für Nadorst, Ofenerdiek und den Stadtnorden. Die Redaktion traf ihn zu einem Gespräch über seine Position und seine Aufgaben in seinem Büro in der Polizeiinspektion am Friedhofsweg.
Sie sind einer von insgesamt drei Kontaktbereichsbeamten in Oldenburg. Für welche Gebiete sind Sie zuständig?
In Oldenburg teilen sich die Kontaktbereichsbeamte (oder auch kurz „Kontaktbeamte“, KOB) in drei Stadtbereiche auf, einmal für den Bereich Oldenburg-Nord: Pferdemarkt, Donnerschwee, Nadorst, Etzhorn, Ofenerdiek und einen Teil von Bürgerfelde. Der andere Teil fällt in den Bereich Oldenburg-Mitte, der umfasst Wechloy, Eversten, Bloherfelde, ein Teil von Osternburg. Der andere Teil und die restlichen Stadtteile fallen in den Bereich Oldenburg-Süd: Dazu gehören Kreyenbrück, Tweelbäke und Bümmerstede. Alle drei zuständigen Beamten haben dafür ein eigenes Dienstfahrrad erhalten.
Was genau sind Ihre Aufgaben? Wie sieht Ihr Arbeitstag aus?
Ich beginne meinen Arbeitstag üblicherweise damit, dass ich morgens als Erstes durch den Stadtnorden fahre; passenderweise wohne ich auch im Stadtnorden. Ich bin dann gute zwei bis zweieinhalb Stunden unterwegs, bevor ich hier in der Polizeiinspektion dann schaue, was sonst noch vorgefallen ist und wo noch Unterstützung benötigt wird. Eine ständige, verlässliche Präsenz in den Stadtteilen zu zeigen, ist eines der Hauptanliegen der Kontaktbereichsbeamten. Deshalb laufe ich später an bestimmten Stellen vornehmlich Fußstreife, weil dies den Vorteil hat, dass man schneller von den Bürgerinnen und Bürgern angesprochen wird als auf dem Fahrrad. Im Bereich des Wochenmarktes am Pferdemarkt gehe ich beispielsweise immer zu Fuß. Auch die offene Drogenszene ist ja unter anderem in unmittelbarer Nähe am Anfang der Nadorster Straße zu finden, auch hier gehe ich vorbei, spreche mit den Leuten. Der Kontakt ist so nahbarer, persönlicher, das erlebe ich immer wieder. Wichtig ist mir, diese Menschen nicht noch mehr auszugrenzen, da sie ohnehin schon am Rande der Gesellschaft leben und wenige Ansprechpartner von außen haben. Ein gewisses Reibungspotenzial ist natürlich vorhanden – gerade durch frühere Erfahrungen –, aber durch den regelmäßigen Kontakt wird mehr Vertrauen und Respekt aufgebaut, weil beide Seiten mehr gemeinsame Berührungspunkte haben.
Zu den Aufgaben eines Kontaktbeamten zählt also, verstärkt im Stadtteil Präsenz zu zeigen.
Tatsächlich hat hier bisher ein wenig die Polizei ‚zum Anfassen‘ gefehlt. Meine Kolleg:innen und ich verstehen uns vor allem als Bindeglied zwischen Gesellschaft und Polizei. Wir sind dabei selten repressiv tätig und weisen z. B. mehr in verkehrserzieherischen Gesprächen auf mögliche Gefahren im Straßenverkehr hin, als dass wir tatsächlich Ordnungswidrigkeiten aufnehmen. Vielmehr verstehen wir uns als Vertreter:innen einer Polizei, die sich die Zeit nimmt, zuzuhören und somit mehr präventiv arbeitet. Man hat erkannt, wie wichtig diese Tätigkeiten sind und daher wurden diese Stellen wieder etabliert. Ein Unterschied ist dabei, dass unsere Arbeit nicht wirklich in Zahlen messbar ist, anders als z. B. bei einer Straftat, die in der Kriminalstatistik vermerkt wird. Wichtiger ist aber, dass unsere Arbeit von der
Bevölkerung gut angenommen wird, viele Leute sprechen uns an („Wo Sie gerade hier sind …“), was ihnen so auf den Nägeln brennt.
Welche Themen beschäftigen die Menschen im Stadtnorden? Mit welchen Anliegen kommen sie zu Ihnen?
Oft sind es verkehrsrechtliche Themen – ein ‚Klassiker‘ ist die Dreißiger-Zone, in der alle Fahrzeuge auf der Fahrbahn parken. Die Anwohner:innen machen sich Sorgen um die Verkehrssicherheit in solchen Fällen, gerade wenn man als Fahrradfahrer:in unterwegs ist. Letztlich ist es hier aber eine Frage der gegenseitigen Rücksichtnahme, die man kommuniziert. Oft hört man auch von der Problematik der ‚Elterntaxis‘ morgens vor den Schulen, was wir letztlich aber auch nicht lösen können. Das ist dann eher eine Angelegenheit für unseren Verkehrssachbearbeiter oder die Stadt. Wir als Kontaktbeamte sind allerdings für die Bürger:innen der Einstieg, um diese Probleme zu benennen, die dann weiter an anderer Stelle bearbeitet werden. Insgesamt sind es viele unterschiedliche Dinge, auch mal die Frage, was mit dem Laub auf dem eigenen Grundstück passieren soll. Oft ist unsere Arbeit eine Mischung aus Ansprechpartner, manchmal auch Streetworker oder soziale ‚Briefkasten‘, was die Leute bewegt oder auch einfach, um ihren Frust abzulassen. Gerade weil man viel zu Fuß unterwegs ist, kann man seine Sinne mehr öffnen, bekommt mehr mit und kann mehr aufnehmen. Wir stehen auch in regelmäßigem Kontakt zu den Bürgervereinen, die in den Stadtteilen ja sehr aktiv
sind, aber in der Pandemie wie viele Vereine in ihren Aktivitäten ausgebremst wurden. Hier sind vor allem die geltenden Corona-Richtlinien ein häufiges Thema.
Stehen Sie auch in Kontakt mit den Händlern und Gewerbetreibenden?
Ich bin viel in der Donnerschweer Straße und der Nadorster Straße zu Fuß unterwegs. Da kommt es schon mal vor, dass
man sich vor dem jeweiligen Laden begegnet, die Leute kurz rauskommen und man sich unterhält. Das hat sich auch mit der Zeit etabliert; man grüßt sich z.B. auch schon durchs Fenster. Wenn es Probleme gibt, werde ich auch direkt angesprochen, wie das beispielsweise bei den Händlern auf dem Wochenmarkt auch der Fall ist. Die eigene Präsenz ist im Vergleich zum Dienst im Dienstwagen viel stärker und ermuntert die Menschen mehr, den Kontakt zu suchen.